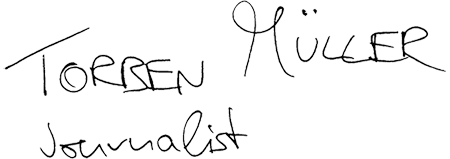Trotz aller Vorahnungen traf die Familie die Nachricht von Matthias‘ Suizid wie ein Schlag aus dem Nichts. Gerade in den Wochen zuvor hatte sich sein Zustand scheinbar gebessert. „Er redete plötzlich wieder, wollte Zeitschriften lesen, hatte Appetit“, sagt Brigitte Gordis. Vier Tage vor Matthias‘ Tod schnitt sie ihm noch einmal die Haare. „Da war er sehr unruhig. Etwas schien ihn zu beschäftigen.“ Am Tag darauf wirkte er beim Besuch seines jüngeren Bruders dann ungewöhnlich gelöst. Zusammen schwelgten sie in Erinnerungen an Blödeleien aus der Kinderzeit. Heute ist Brigitte Gordis sicher, dass er seinen Entschluss zu diesem Zeitpunkt gefasst und sich damit von der Last der Krankheit bereits innerlich befreit hatte. „Wenn es Depressiven plötzlich so gut geht, ist das ein Warnsignal. Dann muss man höllisch aufpassen. Am besten spricht man sie in dem Moment direkt auf mögliche Suizidgedanken an.“
Bevor Matthias begraben wurde, sahen ihn die Eltern noch ein letztes Mal in der Gerichtsmedizin. „Es schien, als schliefe er“, sagt Brigitte Gordis. „Er sah so friedlich aus wie nie zuvor in seinem Leben.“ Und sie fügt einen Satz an, der viele zum Widerspruch reizen wird, die in Depressiven die fremdgesteuerten Werkzeuge ihrer Krankheit sehen: „In diesem Augenblick dachte ich: ‚Er hat die richtige Entscheidung getroffen.‘“
Eine dunkelbraune Haarsträhne, die die Mutter Matthias damals abschnitt, bewahrt sie seither in einem Holzkästchen auf. Zusammen mit einem Stück Draht, das sie später bei seinen Sachen fand. Es ist zu einem Henkersknoten geknüpft. ln einer schwarzen Pappschachtel daneben liegt ein abgeschnittenes Stück Strick, das Matthias auf dem Schreibtisch zurückließ, bevor er in den Park ging. Auf den Außenstehenden mag gerade dieses Andenken befremdlich wirken. Brigitte Gordis hütet es jedoch wie einen Schatz. „Dieses Seilende hat er in seinen letzten Stunden noch in den Händen gehalten, deshalb ist es so wichtig für mich.“
Als die dunkle Ahnung der Vergangenheit plötzlich Gewissheit geworden war, lebte Brigitte Gordis zunächstwie unter einem Schleier. „Der Schock war so groß, dass ich den Verlust meines Sohnes kaum an mich heranließ“‚ sagt sie. „Mein Verstand sagte: Das Kind ist tot. Doch mein Gefühl konnte das nicht akzeptieren. So habe ich mich in den ersten vier, fünf Monaten vor dem Schmerz geschützt.“
Jeder in der Familie trauerte auf seine Weise um Matthias. „Mein ältester Sohn ist seit der Beerdigung nicht mehr ans Grab gefahren und wollte im ersten Jahr nicht, dass der tote Bruder erwähnt wird“, sagt Brigitte Gotdis. „Er und sein jüngster Bruder fangen jetzt erst an, das Geschehene zu verarbeiten. Mein Mann hätte gerne mehr mit mir zusammen getrauert, aber ich konnte das nicht. Wenn es dem einen gerade etwas besser ging, fing der andere an zu weinen. Dann saßen wir beide wieder da und heulten. Da wären wir auf Dauer irgendwann zusammengebrochen.“ Und so fuhr sie mit dem Auto hinaus in die Einsamkeit, um ihren Schmerz herauszuschreien. Immer und immer wieder, Vor allem, als der Schleier sich allmählich lüftete und sie das Leid nun mit voller Wucht traf.
In all den Jahren zuvor hatte Brigitte Gordis ihr Leben zunehmend Matthias‘ Krankheit unterworfen. Als er 17 war und immer größerer Fürsorge bedurfte, gab die gelernte Krankenschwester ihren Job in der Hausarztpraxis ihres Mannes auf. Später, als ihr Sohn in einer eigenen Wohnung lebte, kochte und putzte sie regelmäßig für ihn. Zudem traf sie sich acht Jahre lang wöchentlich mit anderen Angehörigen von Depressiven in einer Selbsthilfegruppe. Nun war da auf einmal diese ungeheure Leere.
Brigitte Gordis hatte schon vor Manthias’ Tod viel Sport getrieben, „weil es wenigstens dem Körper gut gehen soll, wenn die Seele leidet, und Angehörige von psychisch Kranken sich nicht vernachlässigen dürfen“. Jetzt füllte sie mit Trainingseinheiten im Fitnessstudio und ausgedehnten Spaziergängen mit ihren beiden West-Highland-White-Terriern Lisa und Pauline die leeren Stunden.
Einige Monate ging sie zu einer Psychotherapeutin, und noch heute nimmt sie eine minimale Dosis Antidepressiva – „so klein, dass es nach Ansicht der Ärzte eigentlich gar nichts bewirken dürfte, aber mir hilft‘s“. Auf Beruhigungsmittel hat sie dagegen zu Anfang absichtlich verzichtet, selbst am Tag der Beerdigung. Sie habe den Schmerz bewusst wahrnehmen wollen in dem Moment, in dem ihr Kind in die Erde hinabgelassen wurde. Nicht aus Härte gegen sich selbst, sondern um sich für die Zukunft zu schützen. „Mir war klar: Wenn ich in dieser Situation Beruhigungsmittel brauche, werde ich sie womöglich immer brauchen“, sagt sie. Noch immer verwendet sie keine starken Präparate wie Valium und setzt lediglich Johanniskraut ein, um ruhiger zu schlafen.